
Kurzübersicht: In Clemens’ Systemischer Strukturaufstellung (SySt®) im Format „Ausgeblendetes Thema“ geht es um eine Führungsposition und ambivalente innere Seiten. Ein jüngerer Persönlichkeitsaspekt von etwa zehn Jahren wird sichtbar – eng verknüpft mit der Beziehung zum Vater. Zentrale Interventionen der Strukturaufstellungsarbeit führen zu innerer Klärung, gestärktem Selbstbezug und einer neuen beruflichen Ausrichtung.
Beim letzten Mal hast du Clemens und sein Anliegen für eine Systemische Strukturaufstellung kennengelernt. Dabei habe ich dir auch den hypnosystemischen Ansatz nach Gunther Schmidt und zentrale SySt®-Formate vorgestellt (siehe Link).
Heute kehren wir zurück zu Clemens’ Strukturaufstellung.
Wichtiger Hinweis vorab: Namen, Situationen und Begebenheiten sind zwar fiktiv gewählt, um die Abläufe in der SySt®-Praxis realistisch darzustellen. Rückschlüsse auf echte Personen oder Ereignisse sind ausgeschlossen. Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
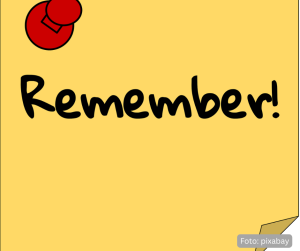
Clemens, Mitte 40, steht vor der Chance auf eine Führungsposition auf höchster Eben – doch innere Blockaden bremsen ihn. Trotz fachlicher Eignung und Zuspruch tauchen Ängste und Selbstzweifel auf.
Im Gespräch zeigen sich zwei innere Seiten: eine antreibende und eine bremsende. Die Arbeit mit dem Seitenmodell von Gunther Schmidt hilft Clemens, diesen Konflikt besser zu verstehen.
Er erkennt, dass sein Widerstand auch mit unbewussten Loyalitäten zu tun haben könnte – etwa gegenüber seiner Mutter, die ihre Karriere als Architektin für die Kinder aufgab.
Auch die frühe Erfahrung mit seinem Vater, der die Familie verließ, wird spürbar, zeigt aber zunächst keinen Bezug zum beruflichen Anliegen.
Wir entscheiden uns, nicht die Herkunftsfamilie aufzustellen, sondern mit Clemens’ innerem System zu arbeiten – konkret mit dem SySt®-Format „Ausgeblendetes Thema“ (AAT).
Das schauen wir uns jetzt genauer an.

Das Format Aufstellung des ausgeblendeten Themas (AAT), das ich für Clemens gewählt habe, gehört zu den strukturell einfacheren SySt®-Formaten. Das sagt aber nichts über die Intensität des Ablaufs oder die Vielfalt der möglichen Ergebnisse aus. Oft wird die AAT auch als Teilstruktur in komplexeren Strukturaufstellungen eingesetzt – dazu ein anderes Mal.
Heute betrachten wir die Grundform der AAT mit drei zentralen Elementen:
In meiner erweiterten Version der AAT, die das Seitenmodell nach Gunther Schmidt integriert, werden neben Clemens’ Fokus auch zwei seiner Persönlichkeitsanteile einbezogen. So ist Clemens zu Beginn der Aufstellung dreifach vertreten: durch seinen Fokus – wie zuvor beschrieben – und durch zwei innere Seiten, die Clemens folgendermaßen benennt:
Da für Clemens auch der mögliche Zusammenhang mit der Geschichte seiner Mutter im Raum steht – und die Frage, ob sich die „Stopp“-Seite aus Loyalität zu ihr blockierend verhält –, beziehen wir die Mutter als gewählte Repräsentantin mit ein. Diese Repräsentantin bleibt am Rand sitzen, wird jedoch in ihrer repräsentierenden Wahrnehmung aktiv einbezogen und kann bei Bedarf direkt ins Geschehen treten (siehe Link).
Ziel der AAT ist es, in Bezug auf das offizielle Thema „Führungsposition“ eine stimmige Verbindung zwischen dem Fokus und den beteiligten inneren Anteilen herzustellen – unter Einbezug dessen, was bei diesem Thema möglicherweise unbewusst mitschwingt.

Zurück im Gruppenraum: Clemens wählt – wie zuvor besprochen – intuitiv die Repräsentierenden aus. Unter meiner Anleitung positioniert er sie im Raum, seiner repräsentierenden Wahrnehmung folgend. Nach dem Stellen des ersten Bildes geben die Repräsentierenden folgende Rückmeldungen (siehe Link):
An dieser Stelle unterbreche ich die Schilderung des Ablaufs, um dich an meinen Überlegungen teilhaben zu lassen, die genau hier im Prozess eine Rolle spielen – und zwar mit Blick auf die SySt®-Grammatik, also die Regeln und Prinzipien, nach denen Interventionen innerhalb einer Strukturaufstellung gestaltet werden.
Meine Hypothese: Das ausgeblendete Thema könnte mit der Vaterbeziehung zu tun haben.
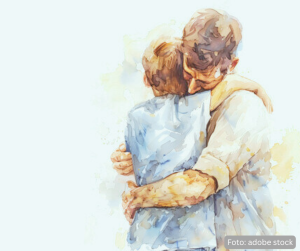
Da diese Hypothese Teil meiner eigenen Realitätskonstruktion ist, überprüfe ich sie auf ihre Stimmigkeit im repräsentierten System. Das heißt: Ich teste, ob sich der Prozess in die von mir vermutete Richtung entwickeln könnte (siehe Link).
Dabei zeigt sich – selbstverständlich heuristisch verstanden –, dass die innere Seite „Go“ mit einem jüngeren Anteil von Clemens überlagert zu sein scheint, etwa im Alter von zehn Jahren.
Doch was bedeutet das konkret?
Damit du dem weiteren Verlauf der Strukturaufstellung besser folgen kannst, vertiefe ich meine Erläuterungen im nächsten Kapitel noch ein Stück – bevor es dann mit Clemens und der Aufstellung des ausgeblendeten Themas weitergeht.
Kontextüberlagerung
In Systemischen Strukturaufstellungen bezeichnet Kontextüberlagerung den Umstand, dass ein aufgestelltes Element nicht nur für sich selbst steht, sondern – meist unbewusst – zugleich Aspekte eines anderen Kontexts repräsentiert, oft auf einer anderen Strukturebene.
Ein Beispiel: Das auf Körperebene aufgestellte Herz steht nicht nur für sich alleine – es trägt zugleich Anteile aus der Herkunftsfamilie. Dabei ist aber nie das ganze Element – in diesem Beispiel das Herz – von der Überlagerung betroffen, sondern nur bestimmte Facetten.

Der Begriff „Kontextüberlagerung“ grenzt sich dabei bewusst von den oft in Aufstellungen verwendeten Begriffen „Verstrickung“ und „Identifikation“ ab, da diese Begriffe ein kausales oder festlegendes Verständnis nahelegen – was dem systemischen Denken widerspricht.
Aus Strukturaufstellungssicht scheinen Kontextüberlagerungen häufig auf verdeckte, vermischte oder verlorene Aspekte im System hinzuweisen. Sie können sich sowohl blockierend als auch unterstützend auswirken – auf Personen, Gruppen, Ereignisse oder abstrakte Größen wie Ziele, Blockaden, Werte oder Traditionen.
Zeigt die repräsentierende Wahrnehmung im aufgestellten System Hinweise auf eine solche Überlagerung, die den Prozess behindern könnte, folgen – nach entsprechender Überprüfung – gezielte Interventionen.
Zwei zentrale Interventionsrichtungen sind:
Für beides gibt es in der Strukturaufstellungsarbeit unterschiedliche methodische Zugänge.
Strukturebenenwechsel
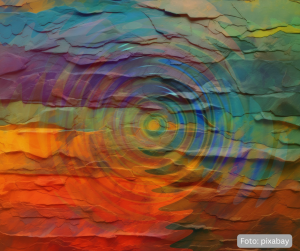 Ein Strukturebenenwechsel liegt vor, wenn während einer Aufstellung Inhalte oder Prozesse aus verschiedenen Systemebenen – etwa Familie, Beruf oder Körper – in Resonanz treten oder sich überlagern.
Ein Strukturebenenwechsel liegt vor, wenn während einer Aufstellung Inhalte oder Prozesse aus verschiedenen Systemebenen – etwa Familie, Beruf oder Körper – in Resonanz treten oder sich überlagern.
Typisch sind überraschende Aussagen von Repräsentierenden, die eher zu einer anderen als zur ursprünglich dargestellten Ebene passen.
Ein Strukturebenenwechsel eröffnet so die Möglichkeit, verschiedene Lebensbereiche gleichzeitig oder übertragend einzubeziehen – oft subtil, aber mit spürbarer Wirkung.
Alter-Ego-Methode und Altersintegration

Die Alter-Ego-Methode ist ein spezieller Ansatz innerhalb der Strukturaufstellungsarbeit, inspiriert von hypnotherapeutischen Konzepten – insbesondere von Stephen Gilligan.
Dabei werden verschiedene Persönlichkeitsanteile zusammengeführt – häufig mit dem Ziel, jüngere, verletzte oder „abgespaltete“ innere Zustände in ein bewusstes, kompetentes Erwachsenen-Ich zu integrieren. Diese sogenannte Altersintegration stärkt die Selbstbeziehung und führt zur einer „Einheit der Person über die Zeit“.
Am Ende der Strukturaufstellung tritt die Klientin oder der Klient selbst ins Bild – zusätzlich zum Fokus, der nun das „fortgeschrittene Selbst“ verkörpert.
In dieser neuen Form wird der Fokus als „weiser innerer Anteil“ verstanden, der künftig an den durchlebten und lösungsfördernden Prozess erinnern kann.
Der beschriebene Prozess verläuft in mehreren aufeinander aufbauenden Sequenzen – mit Blickkontakt, symbolischen Sätzen und kleinen Ritualen.
Durch die körperlich erfahrbare, multiperspektivische Herangehensweise werden tiefgreifende innere Veränderungen möglich, die weit über rein sprachliche Zugänge hinausgehen.
So viel heute zur SySt®-Grammatik – jetzt geht es zurück in den Aufstellungsraum.
Der erste Schritt: Von der innerpsychischen zur familiären Ebene

Clemens beobachtet seine Strukturaufstellung zwar von außen, ist aber stets Teil des Geschehens. Ich beziehe ihn regelmäßig ein und frage, ob das, was sich zeigt, für ihn stimmig ist (siehe Link).
Auch jetzt frage ich nach. Doch diesmal bleibt Clemens zunächst still, den Blick zum Boden gesenkt. Als sich unsere Blicke treffen, sagt er leise – mit Tränen in den Augen, aber klar: „Die Seite Go – das bin ich mit zehn, als mein Vater weggegangen ist. Und das ausgeblendete Thema – das ist mein Vater.“
Damit wird der Strukturebenenwechsel, den ich zuvor bereits vermutet und implizit getestet hatte, deutlich sichtbar. Oder anders gesagt: Der Wechsel wird explizit – denn die beiden Elemente, die bislang der innerpsychischen Ebene zugeordnet waren, beziehen sich nun auf die familiäre Ebene.
Ich frage Clemens, ob er das Vaterthema einbeziehen möchte – dafür brauche ich seinen ausdrücklichen Auftrag. Er stimmt zu.
Somit läuft der Prozess nun explizit auf zwei Ebenen: im Bereich von Clemens’ inneren System und zugleich im Kontext seiner Herkunftsfamilie.
Daher benennen wir die Rollen neu:
Einen neuen Repräsentanten für das ausgeblendete Thema brauchen wir nicht. Denn das, was vorher ausgeblendet war, zeigt sich jetzt – in der Geschichte zwischen Vater und Sohn.
Der zweite Schritt: Eine Begegnung mit dem Zehnjährigen
 Wir setzen die Arbeit mit einer sogenannten Altersintegration fort – einem sehr einfühlsamen, hypnosystemischen Prozess. In der Strukturaufstellungsarbeit geht es dabei nie um ein abstraktes „inneres Kind“, sondern stets um ein jüngeres Selbst in einem bestimmten Alter – in diesem Fall um den zehnjährigen Clemens, so wie er sich damals im Kontext des aktuellen Themas gefühlt hat: traurig, verletzt, allein.
Wir setzen die Arbeit mit einer sogenannten Altersintegration fort – einem sehr einfühlsamen, hypnosystemischen Prozess. In der Strukturaufstellungsarbeit geht es dabei nie um ein abstraktes „inneres Kind“, sondern stets um ein jüngeres Selbst in einem bestimmten Alter – in diesem Fall um den zehnjährigen Clemens, so wie er sich damals im Kontext des aktuellen Themas gefühlt hat: traurig, verletzt, allein.
Der Fokus – also das bewusste Erwachsenen-Ich von Clemens – wendet sich dabei dem Kind von damals zu. Mit bestimmten rituellen Sätzen vermittelt er ihm das, was es damals gebraucht hätte: Halt, Verständnis, Zuwendung.
Clemens beschreibt später, wie tief ihn dieser Moment berührt hat.
Der dritte Schritt: Die Begegnung mit dem Vater im Beisein der Mutter
 Daraufhin begegnet Clemens’ Fokus gemeinsam mit dem zehnjährigen Selbst zunächst dem Vater. In einem achtsam geführten, klar strukturierten Ritual kommt es zu einer versöhnlichen Begegnung – und schließlich zu einer symbolischen Rückgabe an beide Elternteile: Das, was nicht zu Clemens gehört, etwa die unwillkürlich übernommene Verantwortung für das Hinausgehen des Vaters aus der Famlie, darf nun an Vater und Mutter zurückgegeben werden.
Daraufhin begegnet Clemens’ Fokus gemeinsam mit dem zehnjährigen Selbst zunächst dem Vater. In einem achtsam geführten, klar strukturierten Ritual kommt es zu einer versöhnlichen Begegnung – und schließlich zu einer symbolischen Rückgabe an beide Elternteile: Das, was nicht zu Clemens gehört, etwa die unwillkürlich übernommene Verantwortung für das Hinausgehen des Vaters aus der Famlie, darf nun an Vater und Mutter zurückgegeben werden.
Für diesen Schritt tritt auch die Repräsentantin der Mutter aktiv ins Geschehen.
Zwischen Vater und Sohn entsteht dabei keine große Nähe – das wäre auch nicht stimmig, wie Clemens später bestätigt. Doch sein Fokus spürt: Etwas hat sich gelöst. Er fühlt sich kraftvoller, innerlich freier. Und er weiß wieder klarer, wohin er will – und wer er ist.
Die Veränderungen in den dargestellten Systemen

Die Wirkung dieser Prozesse zeigt sich auch bei den anderen Repräsentierenden.
Clemens kommt selbst ins Bild
 In einem von mir angeleiteten, schrittweisen Prozess tritt Clemens am Ende der Strukturaufstellung selbst in die Position seines Fokus, der nun sein fortgeschrittenes Selbst repräsentiert. Allmählich an seinem Platz in der Mitte angekommen, erlebt er sich nun als Teil seines bio-psychischen Systems, eingebettet in sein familiäres Umfeld.
In einem von mir angeleiteten, schrittweisen Prozess tritt Clemens am Ende der Strukturaufstellung selbst in die Position seines Fokus, der nun sein fortgeschrittenes Selbst repräsentiert. Allmählich an seinem Platz in der Mitte angekommen, erlebt er sich nun als Teil seines bio-psychischen Systems, eingebettet in sein familiäres Umfeld.
Wie Clemens später selbst beschreibt, wird ihm durch diese ganzkörperliche Erfahrung in der Systemischen Strukturaufstellung bewusst, wie eng innere und äußere Einflüsse im Alltagserleben miteinander verflochten sind.
Als erstes blickt Clemens zu seinen beiden inneren Seiten, Go und Stopp, spürt ihre Präsenz und Unterstützung – jetzt und auch in Zukunft.
Erleichternd ist für ihn auch die Erkenntnis: Das fortgeschrittene Selbst, verkörpert durch den Fokus, bleibt als weise, unterstützende Instanz an seiner Seite.
Die Führungsposition wirkt stimmig und einladend. Clemens fühlt sich ihr gewachsen – und bereit, konkrete nächste Schritte zu gehen.
Den Vater nimmt er rechts hinter sich wahr – still, aber unterstützend. Auch die wohlwollende Haltung der Mutter berührt ihn und gibt ihm Rückhalt.
Anmerkungen zum Schlussbild
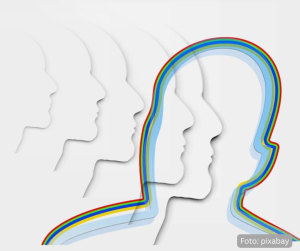
An dieser Stelle möchte ich kurz innehalten und eine persönliche Bemerkung einfügen.
Du hast sicher bemerkt: Nicht nur die Fünffachrepräsentation am Ende, sondern der gesamte Strukturaufstellungsprozess zeigt, wie sensibel und vielschichtig diese Arbeit sein kann. Oft berührt sie emotionale, familiäre, berufliche und körperliche Ebenen – zur gleichen Zeit oder nacheinander.
Deshalb tragen Aufstellungsleitende eine besondere Verantwortung. Neben methodischer Klarheit braucht es vor allem Achtsamkeit, innere Stabilität und professionelle Erfahrung.
Eine fundierte Ausbildung ist also unerlässlich, um Menschen in solchen Prozessen sicher, respektvoll und wirksam begleiten zukönnen (siehe Link).
Sechs Wochen später berichtet Clemens seine Eindrücke und was sich für ihn geklärt hat:
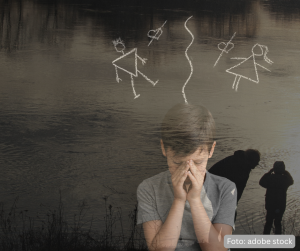
Zum Schluss überrascht Clemens mit einer klaren Entscheidung:
Ein Jahr nach dem letzten Gespräche erzählt mir Clemens:

Damit endet die Schilderung von Clemens’ Auseinandersetzung mit seinen inneren Anteilen. Du hast dabei erneut zentrale Elemente der Systemischen Strukturaufstellungsarbeit kennengelernt.
Lass das Erlebte in Ruhe nachklingen – und sei gern wieder dabei, wenn es das nächste Mal um eine Teamsupervision geht, in der ebenfalls Strukturaufstellungselemente zum Einsatz kommen.
Ich freue mich auf dich!
Klicke direkt ins Bild oder hier: Newsletter
Klicke direkt ins Bild oder hier: Kontakt
Gilligan, Stephen G.:
Schmidt, Gunther :
Schmidt, Gunther & Varga von Kibéd, Matthias :
Sparrer, Insa:
Sparrer, Insa & Varga von Kibéd, Matthias :
Vorhemus, Ursula: